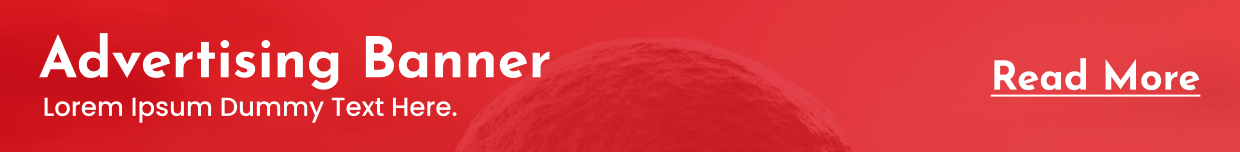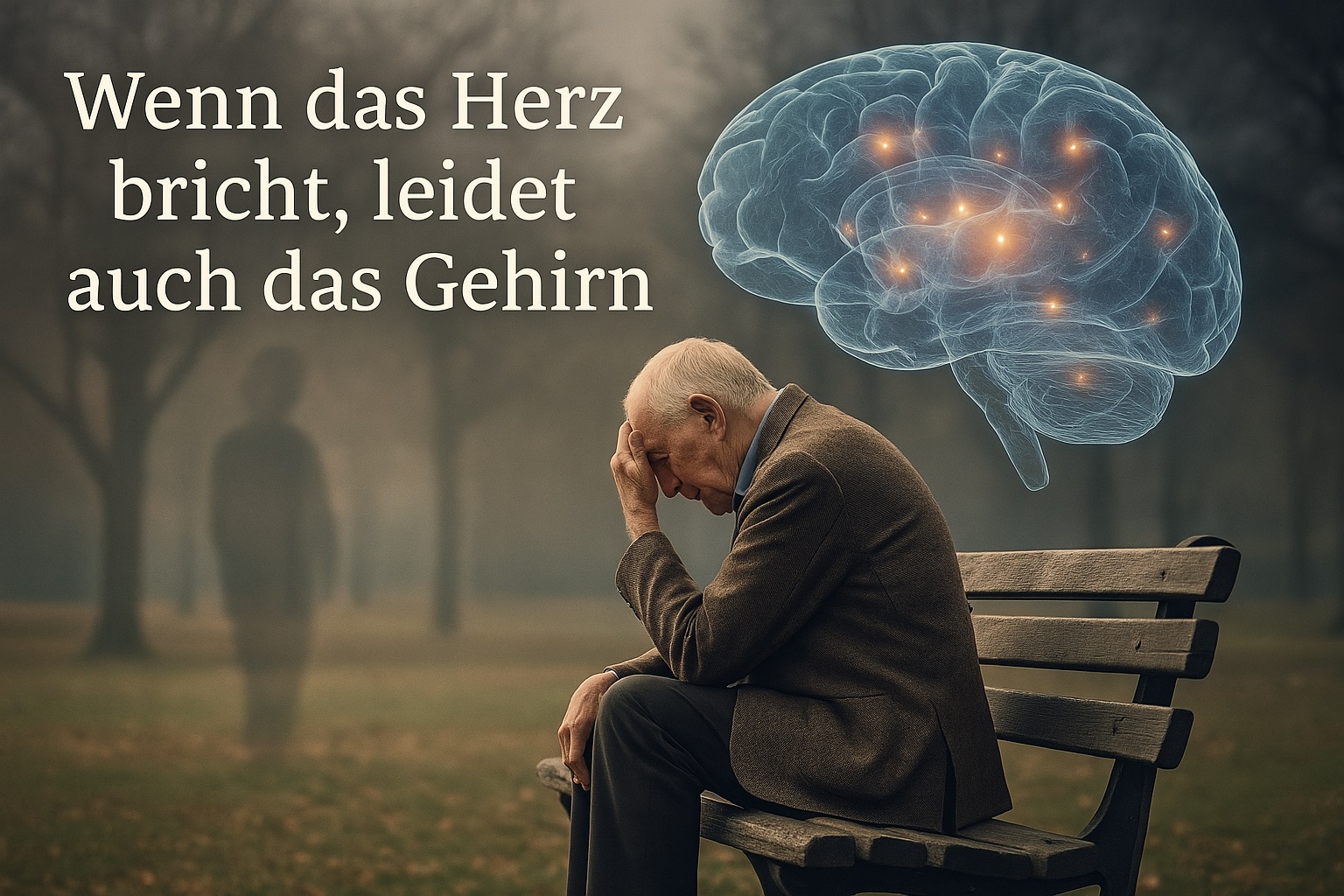Die veröffentlichten RKI-Files, die zuvor geschwärzt waren, werfen eine Reihe von Fragen auf, insbesondere zur Risikobewertung, politischen Einflussnahme und wissenschaftlichen Entscheidungsprozessen während der Corona-Pandemie. Hier sind einige der zentralen Fragen, die sich aus den entschwärzten Dokumenten ergeben:
🔹 Hat das RKI als wissenschaftliche Fassade für politische Entscheidungen gedient? – Es gibt Hinweise darauf, dass politische Akteure Einfluss auf die Risikobewertungen und Maßnahmen genommen haben. 🔹 Warum wurden bestimmte Risikoeinschätzungen getroffen? – Die Hochstufung der Risikobewertung im März 2020 durch den damaligen RKI-Vizepräsidenten Lars Schaade war eine zentrale Grundlage für Lockdown-Maßnahmen. 🔹 Gab es wissenschaftliche Evidenz für die Maskenpflicht? – Die Protokolle zeigen Diskussionen darüber, ob FFP2-Masken nur für Fachpersonal sinnvoll seien. 🔹 Hat das RKI die psychischen Auswirkungen der Maßnahmen ausreichend berücksichtigt? – Es gibt Hinweise darauf, dass die langfristigen Folgen von Lockdowns und Schulschließungen nicht umfassend analysiert wurden. 🔹 War COVID-19 „nicht schwerer als eine Grippewelle“? – Einige interne Diskussionen legen nahe, dass die Gefährlichkeit des Virus unterschiedlich bewertet wurde. 🔹 Gab es eine „Pandemie der Ungeimpften“? – Die Protokolle zeigen, dass das Narrativ der Herdenimmunität durch Impfung möglicherweise genutzt wurde, um den „Impfdruck“ zu erhöhen. 🔹 Hat das RKI Maßnahmen aus China übernommen? – Es gibt Hinweise darauf, dass einige Strategien direkt aus chinesischen Pandemie-Maßnahmen übernommen wurden.
Die entschwärzten Dokumente verstärken das Bild eines behördlichen Ausnahmezustands, in dem wissenschaftliche Erkenntnisse, politische Entscheidungen und öffentliche Kommunikation eng miteinander verwoben waren
Was uns die Corona-Protokolle verraten: Hat das RKI Fakten der Politik geopfert?
Die Corona-Pandemie hat in Deutschland nicht nur gesundheitspolitische Weichenstellungen ausgelöst, sondern auch eine intensive Debatte über die Rolle und Unabhängigkeit wissenschaftlicher Institutionen wie des Robert Koch-Instituts (RKI). Kritiker werfen dem RKI vor, politische Vorgaben über die Faktenlage gestellt zu haben – eine These, die durch die später veröffentlichten Protokolle und Entscheidungen an Brisanz gewonnen hat.
Politische Vorgaben statt Wissenschaft?
Ein zentraler Kritikpunkt lautet, dass das RKI in der Pandemie weniger als unabhängige wissenschaftliche Instanz, sondern vielmehr als verlängerter Arm der Politik agiert habe. Entscheidungen über Maßnahmen wie die Maskenpflicht, Lockdowns oder Kontaktbeschränkungen wurden teilweise unter Umständen getroffen, die Kritiker als wissenschaftlich nicht ausreichend fundiert ansehen.
Besonders umstritten war die Frage, inwieweit das RKI überhaupt unabhängig agieren konnte. Bereits im Frühjahr 2020 kam es zu Berichten, wonach Entscheidungen nicht allein auf Basis der Faktenlage, sondern unter erheblichem politischen Druck getroffen worden seien. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Instituts, der anonym bleiben möchte, berichtete: „Es gab klare politische Erwartungshaltungen, die das RKI nicht ignorieren konnte.“
Der Medizinskandal des Jahrhunderts? Prof. Andreas Sönnichsen und die Kritik an mRNA-Impfungen
Transparenz auf dem Prüfstand
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Transparenz. Viele der Entscheidungen und Empfehlungen des RKI basierten auf internen Modellen und Studien, deren Methodik für die Öffentlichkeit nicht immer nachvollziehbar war. Besonders im Nachhinein wurden einige Studien infrage gestellt, die als Grundlage für weitreichende Maßnahmen dienten. Kritiker fordern mehr Einsicht in die Entscheidungsprozesse, um besser nachvollziehen zu können, wie Maßnahmen zustande kamen.
„Es war eine Ausnahmesituation, ja. Aber gerade in solchen Zeiten ist Transparenz entscheidend, um Vertrauen zu schaffen“, erklärt die Epidemiologin Dr. Martina Keller. „Das RKI hätte offener darlegen müssen, wie es zu seinen Empfehlungen kam.“
Gerichtsurteil: Die Wahrheit hinter den Protokollen
Im seit 2021 laufenden Verfahren von Multipolar gegen das Robert Koch-Institut (RKI) zur Veröffentlichung und weiteren Entschwärzung der Protokolle des RKI-Krisenstabes hat das Verwaltungsgericht Berlin am 4. November 2024 ein Urteil gesprochen. Die Kernfrage vor Gericht war, ob die von Multipolar erklagten und stark geschwärzten Protokolle mit den ungeschwärzten Dokumenten identisch sind, die durch ein Leak von der Journalistin Aya Velazquez im Juli 2024 an die Öffentlichkeit gelangten.
Das Gericht stellte fest, dass die geleakten und erklagten Dokumente identisch sind. Multipolar-Mitherausgeber Paul Schreyer betonte nach der Urteilsverkündung, dass diese Bestätigung wesentlich sei, da das Leak damit „Beweiskraft in anderen Gerichtsverfahren“ habe. Die ungeschwärzten Protokolle könnten nun als bestätigte amtliche Dokumente gelten und bei der juristischen Aufarbeitung der Pandemiepolitik eine zentrale Rolle spielen.
Wissenschaft bewusst ignoriert?
Die brisanten Inhalte der geleakten Protokolle legen nahe, dass das RKI über die wissenschaftliche Faktenlage bestens informiert war und dennoch Entscheidungen zugunsten politischer Vorgaben traf. Im Rahmen des MWGFD-Pressesymposiums am 26. Oktober 2024 hielt Prof. Dr. Andreas Sönnichsen einen Vortrag, der diese Punkte auf den Punkt brachte. In drei zentralen Aussagen zeigte er auf, wie wissenschaftliche Erkenntnisse bewusst missachtet wurden:
- Maskenpflicht und Lockdowns: Interne Protokolle belegen, dass das RKI frühzeitig wusste, dass Lockdowns nur begrenzte Wirkung auf die Virusausbreitung haben, dennoch wurden sie als alternativlos dargestellt.
- Impfstrategie: Berichte aus dem Krisenstab zeigen, dass Sicherheitsbedenken zu bestimmten Impfstoffen ignoriert wurden, um die Impfkampagne politisch durchzusetzen.
- Kommunikation der Unsicherheit: Obwohl die Datenlage oft unsicher war, wurden Maßnahmen mit unhaltbarer Sicherheit kommuniziert, um die Öffentlichkeit zu beruhigen.
Eine dynamische Faktenlage – oder ein Vorwand?
Das RKI verteidigte seine Entscheidungen häufig mit der dynamischen Faktenlage. Zu Beginn der Pandemie habe man viele Entscheidungen unter Unsicherheit treffen müssen, da das Virus und seine Auswirkungen zu diesem Zeitpunkt kaum erforscht waren. Doch diese Argumentation überzeugt nicht alle.
„Das Problem war nicht die Unsicherheit, sondern der fehlende Willen, diese Unsicherheit zu kommunizieren“, meint der Journalist Thomas Meier, der die Pandemiepolitik seit 2020 kritisch begleitet hat. „Die Politik wollte klare Handlungsanweisungen – und das RKI lieferte diese, auch wenn die Datenlage sie nicht immer rechtfertigte.“
Unabhängigkeit gefordert
Die Debatte um die Rolle des RKI wirft auch grundsätzlichere Fragen auf: Wie unabhängig können wissenschaftliche Institutionen in einem politischen Kontext agieren? Das RKI ist eine dem Bundesgesundheitsministerium nachgeordnete Behörde – ein Umstand, der seiner wissenschaftlichen Neutralität Grenzen setzt.
Für viele Kritiker ist klar: Es braucht eine institutionelle Reform, um die Unabhängigkeit des RKI zu stärken. „In einer Krise wie der Pandemie müssen wissenschaftliche Erkenntnisse ohne politische Einflussnahme erhoben und kommuniziert werden“, fordert der Politikwissenschaftler Prof. Stefan Lange. „Andernfalls droht ein Verlust an Vertrauen, der langfristig schwerwiegende Folgen haben kann.“
Aufarbeitung notwendig
Die Aufarbeitung der Pandemiepolitik ist in vollem Gange, und das RKI wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Die Veröffentlichung von Protokollen und internen Dokumenten könnte Licht in einige der umstrittensten Entscheidungen bringen. Doch für viele Kritiker steht schon jetzt fest, dass das RKI in der Pandemie zu stark von politischen Vorgaben geleitet wurde.
„Wir müssen die Lehren aus dieser Krise ziehen“, betont Dr. Keller. „Eine Stärkung der wissenschaftlichen Unabhängigkeit und eine Kultur der Transparenz sind unverzichtbar, um in künftigen Krisen besser vorbereitet zu sein.“
Fazit
Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Welt, sondern auch das Vertrauen in wissenschaftliche Institutionen erschüttert. Das RKI sieht sich der Kritik ausgesetzt, die Faktenlage zugunsten politischer Vorgaben missachtet zu haben. Die Diskussion darüber, ob das Institut seiner Rolle gerecht wurde oder Reformen notwendig sind, wird noch lange andauern – und könnte die Weichen für den Umgang mit künftigen Krisen stellen.
Bericht: Kritischer Blick auf das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Politik in der Corona-Krise
Beteiligte Personen und Organisationen
Dr. Ronald Weikl:
Als Mitglied der „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ (MWGFD) äußert Dr. Weikl scharfe Kritik an den Corona-Maßnahmen und bezeichnet das Robert-Koch-Institut (RKI) als „Schaltzentrum des Verbrechens“. Er wirft dem RKI und den politisch Verantwortlichen vor, wissenschaftliche Erkenntnisse systematisch missachtet und manipuliert zu haben, um politische Entscheidungen zu legitimieren.
Prof. Dr. Andreas Sönnichsen:
Ein führender Experte für evidenzbasierte Medizin, der für seine kritische Haltung bekannt ist. Er hebt hervor, dass er aufgrund seiner Ansichten zu den Corona-Maßnahmen berufliche Konsequenzen erfahren habe, darunter den Verlust seiner Professur. Seine Analysen basieren auf langjähriger wissenschaftlicher Arbeit, insbesondere zur Patientensicherheit und Übermedikamentierung. Sönnichsen analysierte die RKI-Protokolle und deckte zahlreiche Widersprüche zwischen wissenschaftlichen Fakten und politischen Entscheidungen auf.
Robert-Koch-Institut (RKI):
Als zentrales Gesundheitsinstitut Deutschlands sollte das RKI während der Corona-Krise wissenschaftlich fundierte Politikberatung leisten. Die veröffentlichten Protokolle des RKI-Krisenstabs werfen jedoch den Verdacht auf, dass das Institut politischem Druck unterlag und wissenschaftliche Erkenntnisse zugunsten vorgegebener Narrative ignorierte.
Bundesministerium des Innern (BMI):
Nach den Protokollen war das BMI maßgeblich daran beteiligt, Maßnahmen wie Massentests und Risikohochstufungen politisch durchzusetzen, unabhängig von der wissenschaftlichen Datenlage.
Vorgänge und Kritikpunkte
- Manipulation der Pandemie-Risikoanalyse:
Dr. Weikl und Prof. Sönnichsen kritisieren die Hochstufung des Pandemierisikos am 17. März 2020 als politisch motiviert. Epidemiologische Daten der Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) zeigten, dass keine relevante SARS-CoV-2-Zirkulation vorlag. Die ersten positiven PCR-Testergebnisse im Sentinel-Netzwerk stammten von einzelnen Skiurlaubern, während Massentests zu einer künstlichen Aufblähung der Fallzahlen führten. Laut Sönnichsen waren diese Fakten dem Krisenstab des RKI bekannt, wurden jedoch ignoriert, um restriktive Maßnahmen zu rechtfertigen. - Massentests und falsch-positive Ergebnisse:
Der RKI-Krisenstab warnte ausdrücklich vor der Testung asymptomatischer Personen, da diese methodisch zu einer hohen Zahl falsch-positiver Ergebnisse führen. Dennoch setzte die Politik auf ungezielte Massentests, wodurch ein verzerrtes Bild der Pandemie entstand. Dr. Weikl und Prof. Sönnichsen bewerten dies als gezielte Strategie, um die öffentliche Wahrnehmung zu manipulieren. - Maskenpflicht ohne wissenschaftliche Grundlage:
Beide Kritiker bemängeln die Einführung der Maskenpflicht, obwohl die wissenschaftliche Evidenz keinen Nutzen im Alltagskontext belegt. Sönnichsen verweist auf ein Cochrane-Review, das weder für den Gesundheitsbereich noch für die Allgemeinbevölkerung ausreichende Belege für die Wirksamkeit von Masken fand. Zudem betonte der Krisenstab die Risiken durch Maskentragen, wie gesundheitliche Nebenwirkungen, welche in den politischen Maßnahmen ebenfalls unberücksichtigt blieben. - Das Narrativ der „Pandemie der Ungeimpften“:
Laut Sönnichsen zeigten die RKI-Protokolle klar, dass die Impfungen nicht vor einer Virusübertragung schützen. Dennoch trugen Politik und Medien im Herbst 2021 das Narrativ der „Pandemie der Ungeimpften“ vor, um Druck auf Ungeimpfte auszuüben. Der Krisenstab konnte diese falschen Darstellungen nicht öffentlich korrigieren, da dem RKI laut Protokollen ein „Maulkorb“ auferlegt wurde. Dies habe, so die Kritiker, das Vertrauen in die Wissenschaft massiv geschädigt.
Zusammenfassung und kritische Reflexion
Die in den RKI-Protokollen offengelegten Vorgänge offenbaren ein beunruhigendes Bild: Wissenschaftliche Erkenntnisse wurden wiederholt politisch instrumentalisiert. Die Kritik von Dr. Weikl und Prof. Sönnichsen hebt hervor, dass Maßnahmen wie die Risikohochstufung, die Maskenpflicht und die Massentests auf politischem Druck basierten, anstatt auf einer fundierten wissenschaftlichen Grundlage.
Die Unabhängigkeit des RKI wurde durch politischen Einfluss untergraben. Dies zeigt sich besonders in der Handhabung der Massentests und der Verbreitung irreführender Narrativen wie der „Pandemie der Ungeimpften“. Beide Experten mahnen, dass die Corona-Krise nicht nur das Vertrauen in die Gesundheitsinstitutionen, sondern auch in die Wissenschaft insgesamt beschädigt hat. Es ist dringend erforderlich, die Verflechtung von Wissenschaft und Politik kritisch aufzuarbeiten, um ähnliche Fehler in zukünftigen Krisen zu vermeiden.

Weiterführende Informationen auf: https://www.kla.tv/31453